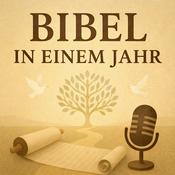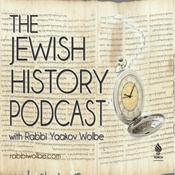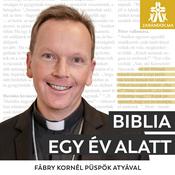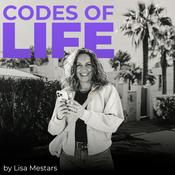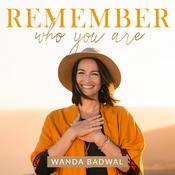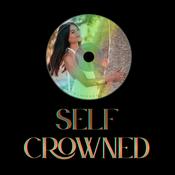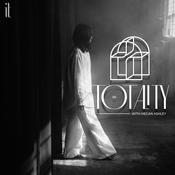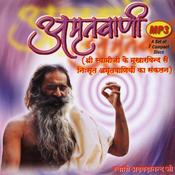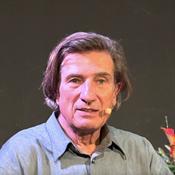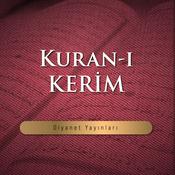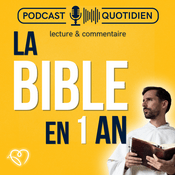Ausgeglaubt: ein RefLab-Podcast
Manuel Schmid & Stephan Jütte

Neueste Episode
247 Episoden
- Anhand der Epstein-Enthüllungen sowie aktueller Skandale um pfingstlich-charismatische Persönlichkeiten diskutieren Manuel und Stephan die Frage, ob Macht dem Menschen einfach nicht gut tut – oder ob sie nur an die Oberfläche bringt, was in ihm schon immer schlummert…
Gemeinsam unterscheiden die beiden zwischen einer psychologisierenden Perspektive, die auf Charakter, individuelle Entscheidungen und persönliches Begehren fokussiert, und einer systemischen Sicht, die Macht als Geflecht aus Abhängigkeiten, Loyalitäten und stillschweigenden Übereinkünften versteht. Geht es um unterdrückte Wünsche, die durch Macht durchgesetzt werden können – oder ist sexualisierte Gewalt eher Symptom und Eintrittskarte in verschworene Kreise, in denen Schuld, Schweigen und gegenseitige Erpressbarkeit Macht stabilisieren?
Neben diesen schweren Fragen erfahrt ihr in dieser Folge auch Erstaunliches und eher Unerwartetes: Neues über Manuel als Handwerker, und warum er aktuell aussieht, als hätte er eine kleine, aber sehr böse Katze adoptiert – und was es mit den gemeinsamen Fitnessplänen von Manuel und Stephan auf sich hat… - Vom Glauben reden: Warum fühlt es sich in reformierten Kontexten so schnell peinlich an – und wann wird es plötzlich berührend? In dieser Folge suchen Manuel und Stephan nach einer Sprache, die nicht überwältigt, aber auch nicht verstummt.
Vom Glauben reden – das klingt einfach. Und ist doch erstaunlich schwer. Warum entschuldigen wir uns oft schon beim ersten Satz? Warum erklären wir alles, kontextualisieren, differenzieren, und grenzen uns vorsorglich von evangelikalen Positionen ab, bis vom Eigenton kaum mehr etwas übrig bleibt?
Wir reden darüber, was es heisst, unter säkularen Bedingungen über Gott zu sprechen: Wenn Glaube nicht mehr selbstverständlich ist, wird er nicht automatisch spannender, nur weil man ihn noch besser erklärt. Vielleicht braucht es weniger Fussnoten – und mehr Mut zur eigenen Stimme. Wir fragen, wo Absicherung notwendig ist, wo sie zur Grundhaltung wird, und wie reformierte Glaubenssprache wieder schlicht, verständlich und verantwortlich klingen kann.
Und weil das Leben zuverlässig dazwischenfunkt: Manu merkt, dass er nicht mehr der Hauptverdiener der Familie ist. Stephan stolpert über eine digitale Selbstüberschätzung. Zwei kleine Reality-Checks, die erstaunlich gut zur grossen Frage passen: Wie spricht man ehrlich, ohne sich zu verstecken? - Plötzlich wieder Glaube: Zwischen Taufzahlen, TikTok-Frömmigkeit und Kirchenbänken voller Gen Z fragen Manuel und Stephan, was hinter dem vermeintlichen Erweckungstrend steckt – und was er der evangelisch-reformierten Kirche wirklich abverlangt.
In dieser Folge sprechen Manuel und Stephan über ein Phänomen, das in den letzten Monaten immer häufiger auftaucht: Junge Menschen interessieren sich wieder für Glauben, Kirche und Spiritualität. In Grossbritannien steigen die Kirchenbesuche der Generation Z deutlich an. In Frankreich lassen sich so viele junge Erwachsene taufen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auf TikTok, YouTube und Instagram entdecken Millionen religiöse Inhalte – von Gebeten bis zu sehr klaren Glaubensbekenntnissen. Die Phänomene werden unter dem Begriff des «Quiet Revival» gefasst, eine stille Erweckungsbewegung also, welche das Potenzial haben könnte, den Säkularisierungstrend aufzuhalten und die Kirchenbänke wieder zu füllen...
Was ist da los? Wir schauen genauer hin: Was sagen die Zahlen wirklich – und wo beginnt der Hype?
Geht es um Sinnsuche in Krisenzeiten, um Gemeinschaft gegen Einsamkeit, um Orientierung in einer überfordernden Welt? Welche Rolle spielen digitale «Christfluencer», neue Frömmigkeitsformen – aber auch politische Gegenbewegungen und kulturelle Abgrenzungen?
Und wir stellen die Frage, die uns als reformierte Christ:innen besonders betrifft:
Was bedeutet das für die evangelisch-reformierte Kirche? Sind wir anschlussfähig für junge Sinnsuchende – oder stehen wir uns mit unserer eigenen Milieuverengung im Weg? Sind wir als stark akademisch geprägte Kirche offen genug für andere Formen von Spiritualität, andere Sprachen des Glaubens, andere Zugänge zu Gott?
Oder erklären wir Glauben so gut, dass man ihn gar nicht mehr ausprobieren kann?
Ausserdem erzählt Manuel zu Beginn, wie ihn einer der Zwerghasen auf Trab hält, der letzte Woche krank geworden ist – und Stephan erinnert sich an einen Snowboard-Tag, der ihn wieder mit der Welt versöhnt hat... - Der Januar ist der Monat der Klarheit. Plötzlich wissen wir genau, wie das Leben eigentlich laufen sollte: weniger Bildschirm, mehr Bewegung. Weniger Stress, mehr Sinn. Weniger Zucker, mehr Achtsamkeit. Das Wissen ist da – die Einsicht auch. Und trotzdem zeigt die Erfahrung jedes Jahr aufs Neue: Wissen allein verändert erstaunlich wenig.
In dieser Folge fragen Manu und Stephan, warum Neujahrsvorsätze so oft scheitern – und was das mit unserem Verständnis von Veränderung, Freiheit und Spiritualität zu tun hat. Vielleicht liegt das Problem gar nicht darin, dass wir zu wenig wissen, sondern dass wir Veränderung als Frage von Information und Willenskraft missverstehen. Genau hier wird es spirituell interessant: Denn auch im Evangelium geht es nicht zuerst um ein Mehr an Wissen, sondern um Praxis. Um Wege, die gegangen werden. Um Haltungen, die eingeübt werden. Um ein Leben, das sich nicht aus Vorsätzen speist, sondern aus Beziehungen, Rhythmen – und manchmal auch aus Scheitern.
Im Stossgebet berichtet Manu von seinem ganz alltäglichen Ärger mit der örtlichen Grünabfuhr. Und im Halleluja erzählt Stephan von einer unerwarteten Erfahrung von Gemeinschaft beim Apéro in seiner Lieblingsbar.
Im Hauptteil des Gesprächs geht es unter anderem um diese Fragen:
Warum Wissen nicht dasselbe ist wie Veränderung.
Warum Vorsätze das Ich oft überfordern.
Warum das Evangelium weniger Botschaft als Übungsraum ist.
Warum Rhythmen wichtiger sind als Ziele.
Warum Scheitern kein Gegenargument gegen Praxis ist.
Und warum Freiheit nicht durch Selbstoptimierung entsteht, sondern durch Einbindung.
Eine Folge über Neujahrsvorsätze – und über die tiefere Frage dahinter: Wer will ich eigentlich sein? - Zuerst: der Jahresbeginn wurde in der Schweiz von einer schlimmen Tragödie überschattet: 40 Menschen sind in Crans-Montana beim Brand einer Bar ums Leben gekommen, über 100 weitere sind schwer verletzt. Manuel und Stephan verzichten auf die üblichen Einstiegskategorien «Hallelujah der Woche» und «Stossgebet der Woche» und gedenken der Opfer dieser Katastrophe.
Zum Thema dieser Woche:
Ist die junge Generation wirklich gottlos – oder schauen wir einfach durch die falsche Brille? In dieser Folge fragen Manuel und Stephan, was Generationenlabels leisten, wo sie schaden – und warum Glauben sich selten an Zielgruppenstrategien hält.
«Generation Golf», «Generation Maybe», «Generation Beziehungsunfähig»: Unzählige Generationenbezeichnungen machen die Runde, entsprechende Bücher: Bestseller – versuchen, Alterskohorten zu beschreiben, unter gemeinsamen Eigenschaften zusammenzufassen.
Und Kirchen greifen diese Begriffe gerne auf und fragen sich: Wie erreichen wir diese Menschen? Was müssen wir tun, wie die Botschaft verpacken, welche Sprache sprechen und welche Jeans tragen, um bei dieser Generation zu landen?
Stephan hat sich letzte Woche über einen NZZ-Beitrag aufgeregt, der die Generation «Alpha» als «lebensunfähig» schlechtredete – und dabei zeigte, wo die Grenzen und Gefahren solcher Beschreibungen liegt: man schert ganze Jahrgangsgruppen über einen Kamm… und lässt dabei meist sozioökonomische Hintergründe, Milieuzugehörigkeiten, Klassenunterschiede ausser Acht. Den einzelnen Menschen wird das nicht gerecht.
Denn es doch klar: Diese Generationen gibt es ja gar nicht (und auch nicht die verschiedenen «Milieus»): das sind alles Abstraktbegrife, die versuchen, die grossen Linien zu sehen. Die aber gerade dann gefährlich werden, wenn sie die persönliche Auseinandersetzung mit einzelnen Menschen zu ersetzen drohen. Wenn sie zu einer Brille werden, mit der man eine «Generation» wahrnimmt, um dann die «Kommunikation des Evangeliums» darauf auszurichten: Die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei zu Kopfgeburten kommt, zu Versuchen, die zu Scheitern verurteilt sind, ist gross.
Aber was stattdessen tun? Manuel und Stephan diskutieren über gelungene und misslungene Versuche, die christliche Botschaft zu kontextualisieren, über ein Evangelium, dass sich in verschiedenen Lebenswelten inkarniert – und über Kirchen, die oft verpassen, Formen des Glaubens und der Nachfolge Jesu überhaupt zu sehen, wenn sie nicht den eigenen institutionellen Erwartungen entsprechen…
Eine Folge über die Grenzen von Etiketten, die Sehnsucht nach Verstehen – und die Einsicht, dass Glauben meist dort entsteht, wo niemand ihn geplant hat.
Weitere Religion und Spiritualität Podcasts
Trending Religion und Spiritualität Podcasts
Über Ausgeglaubt: ein RefLab-Podcast
Was heisst das eigentlich, Christ zu sein? Woran glauben Christen und was können sie getrost aufgeben? Logisch, dass sich Manuel Schmid & Stephan Jütte dabei nicht immer einig sind. Aber sie versuchen in diesem Podcast zusammen herauszufinden, was für sie wirklich zählt und was ihnen eher im Weg steht. Und klar: Beide wissen es auch nicht wirklich. Aber vielleicht regt es dich an zum Mitdenken. Oder es regt dich auf und du magst mit ihnen streiten. Oder du schreibst ihnen einfach mal, was du nicht mehr glauben kannst oder musst oder willst.
Podcast-WebsiteHöre Ausgeglaubt: ein RefLab-Podcast, The Science & Faith Podcast und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App

Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen


Ausgeglaubt: ein RefLab-Podcast
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.