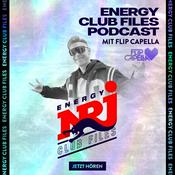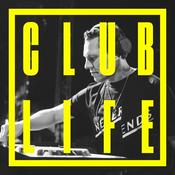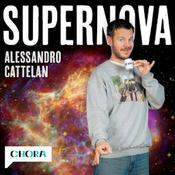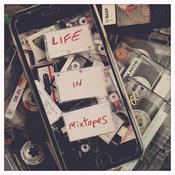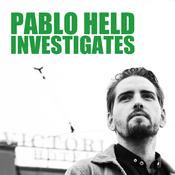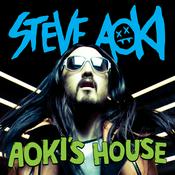123 Episoden
- Nett war das ja nicht gerade, dass der wieder einmal finanziell klamme Richard Wagner seinem Mäzen Otto Wesendonck kurzerhand dessen Frau Mathilde ausspannte - aber als Herr Wesendonck nach Hinweisen von Wagners Noch-Ehefrau Minna die Liaison beendete, reiste der Komponist nach Venedig und hatte wohl das richtige Feeling für die Vollendung seiner Oper "Tristan und Isolde".
Was für die Klatschpresse gut ist, hatte in diesem Fall aber auch ein künstlerisches Ergebnis: die fünf Wesendonck-Lieder, die ihre Nachbarschaft zum Tristan kaum verleugnen können. Paul Bartholomäi stellt die Lieder auf (nicht allzu glücklich geratene) Gedichte von Mathilde Wesendonck vor und erklärt auch den "Trick, mit dem Wagner seine Zuhörer einfängt und betäubt". Notenschlüssel - Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta
17.2.2026 | 1 Std. 24 Min."Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta" - der Titel klingt gerade so, als müsste er sich, juristisch korrekt, neben den Paragraphen in einem Amtsblatt behaupten. Aber Bartók war korrekt, mehr noch: genau, vielleicht sogar penibel; und "Sinfonie" wollte er das viersätzige Stück nicht nennen.
Was hat es mit diesem "Klassiker der Moderne", der nun auch schon 90Jahre auf dem Buckel hat, auf sich? Paul Bartholomäi nähert sich dem seltsamen Stück mit den noch heute ungewöhnlichen Klangfarben, mit den eigenartigen "Bartók-Intervallen" und mit den Konstruktionsprinzipien des sorgsamen Komponisten, der - wie auch Schönberg oder Hindemith - nach einer neuen Ordnung in der Welt der Töne jenseits der Dur-Moll-Tonalität suchte.- Was die Bildhauerei und Architektur kann, kann die Musik schon lange: Grabmäler bauen. Zahlreiche Requiem-Vertonungen aus allen Epochen zeugen davon, aber die Musiker arbeiteten auch in anderen Materialen: In Russland wählten die Komponisten zeitweise gerne Klaviertrio, Maurice Ravel nahm "sein Instrument", das Klavier, oder alternativ Orchester.
Ravels "Le Tombeau de Couperin" kommt allerdings fast zweihundert Jahre zu spät - Couperin starb ja bereits 1733. Aber Ravel-Kenner wissen: Seine Überschriften sind nicht immer ganz wörtlich zu nehmen. Paul Bartholomäi versucht, das Geheimnis um den Titel dieser berühmten Komposition Ravels zu lüften, und stellt dabei das Werk in seinen beiden "Materialien" vor. Er lässt Ravel selbst am Klavier Platz nehmen, stattet seinem Haus in Montfort-l’Amaury (mit musikalischen Mitteln) einen Besuch ab, und es erklingen auch Cembalostücke des klassischen Meisters François Couperin. - Den Namen Albert Lortzing liest man in den Spielplänen der Opernhäuser heute nur noch selten. Dabei wurden noch vor wenigen Jahrzehnten seine Bühnenwerke häufig gespielt, und der "Holzschuhtanz" fehlte in kaum einem Wunschkonzert im Radio.
Paul Bartholomäi versucht zu erklären, warum die Opern des Theaterkomikers Albert Lortzing so viel an Popularität verloren haben, geht den Qualitäten, aber auch Schwächen seiner Werke nach und gibt, ausgehend von "Zar und Zimmermann", auch akustische Einblicke in den "Wildschütz" oder die erst posthum uraufgeführte Oper "Regina". - Vergleichen wir die "klassische Musik" mit einem Teich, könnte man sagen: Wir hören heute nur noch die Frösche quaken. Was sich aber um deren herausragende Stimmen sonst noch in diesem Biotop getummelt hat, das haben wir zum allergrößten Teil vergessen.
Das "Gebet einer Jungfrau" aus der Feder der polnischen Komponistin Thekla Badarzewska-Baranowska etwa ist eines der vielen Lebewesen, die wir uns im selben Teich, in dem auch ein Chopin schwamm, ebenfalls vorstellen müssen: eine Art musikalischer Amöbe, wenig entwickelt, wenig differenziert, von ständigen Wiederholungen ge(kenn)zeichnet - und seinerzeit sensationell erfolgreich. Paul Bartholomäi nimmt sich solcher Werke am Rande des "klassischen" Repertoires an, beschäftigt sich mit dem Thema "Kitsch", aber auch mit dem meist zur Pose degenerierten Genre "Operngebet", und stellt natürlich die Frage, ob nicht auch bei den Tonheroen des 19. Jahrhunderts Tschaikowsky, Gounod oder Chopin billige Salonmusik durchschimmert.
Weitere Musik Podcasts
Trending Musik Podcasts
Über hr2 Notenschlüssel
Klassische Musik – noch Fragen? Paul Bartholomäi gibt ganz persönliche Antworten: In jedem Podcast entschlüsselt er ein anderes Werk, lässt Zusammenhänge hörbar werden, führt in die Welt der Komponisten. Weitere Folgen gibt’s hier ab dem 23. September.
Podcast-WebsiteHöre hr2 Notenschlüssel, Klassik für Taktlose und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App
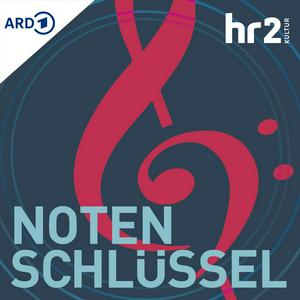
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen

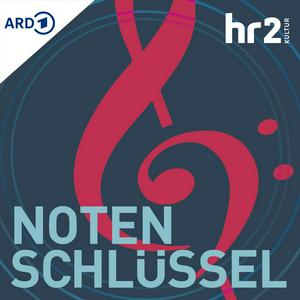
hr2 Notenschlüssel
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.