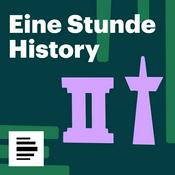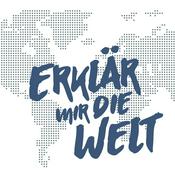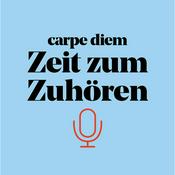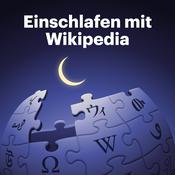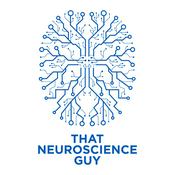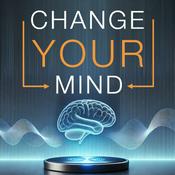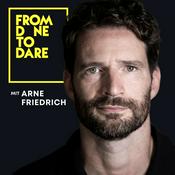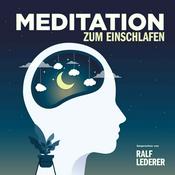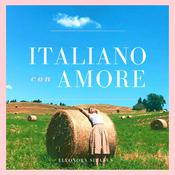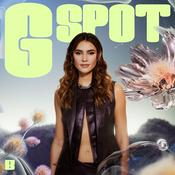EVOMENTIS - Neurodiversität, ADHS, Autismus und darüber hinaus

58 Episoden

🏃🎉 Start Staffel 2 - Ich kriegs nicht hin ...
03.1.2026
In dieser Episode von Evomentis, starten wir ins neue Jahr und tauchen ein in das Thema des "homofunktionalen Menschen". Ich teile meine persönlichen Herausforderungen und Erfahrungen, dabei, wie das äußere Schema der Leistungsanforderungen, sei es im Alltag oder in der Podcast-Welt, oft wenig Rücksicht auf unsere individuellen Bedürfnisse nimmt. Mit einem banalen, aber alltagsnahen Beispiel reflektiere ich darüber, wie die Erwartungshaltung, regelmäßige Inhalte zu liefern, oft zu einer inneren Zerreißprobe führt. Ich beschreibe, wie die Digitalisierung und insbesondere die Algorithmen in der Podcast-Welt uns in ein starreres Funktionieren drängen und dabei menschliche Bedürfnisse ignorieren. Diese Abhängigkeit von externen Vorgaben führt dazu, dass wir uns anpassen, obwohl wir dabei oft den Kontakt zu uns selbst verlieren. Ich spreche darüber, wie ich mich bei der Vorbereitung dieser Folge in ein Netz aus Erwartungen verstrickt habe und wie das schließlich zu einer Blockade führte. Doch gerade in diesem Kampf um die eigene Identität im System, fand ich den Anknüpfungspunkt für diese Episode. Ein zentrales Element meiner Reflexion ist die Vorstellung des funktionsfähigen Menschen und wie wir durch gesellschaftliche Normen geformt und gedrillt werden. Ich greife auf die Idee zurück, dass schon die Industrialisierung unser Verständnis von Effizienz und Funktionalität stark geprägt hat und skizziere, wie das heute im Alltag und an Arbeitsplätzen noch immer sichtbar ist. Die zunehmende Erwartung, voll leistungsfähig zu sein, ignoriert oft die emotionalen und körperlichen Bedürfnisse, wodurch Menschen in stressige Situationen getrieben werden. Ich beleuchte auch die Verbindung zwischen neurodivergenter Wahrnehmung und den Herausforderungen, mit denen viele Betroffene im Alltag konfrontiert sind. Hierbei wird deutlich, dass es nicht fehlende Motivation oder Unwillen ist, sondern oft ein tiefes Ungleichgewicht im Zusammenspiel von Umwelt, Emotion und Leistung ist. Anhand von Beispielen verdeutliche ich, dass viele neurodivergente Menschen viel stärker auf ihre Gefühle reagieren und dass sie sich unter Umgebungsbedingungen oft erheblich anstrengen müssen, um die gleichen Anforderungen zu erfüllen wie neurotypische Menschen. Diese Episode dient nicht nur als Einführung in das Thema, sondern sucht auch nach Wegen, wie wir wieder mehr in Kontakt mit unseren Bedürfnissen kommen können. Ich lade die Hörer ein, darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, sich selbst inmitten von Druck und Schema ernst zu nehmen. Letztendlich betone ich, dass wir in der heutigen Gesellschaft oft nicht perfekt funktionieren müssen und dass es wertvoll ist, Pausen zu machen und Prioritäten neu zu setzen. Diese Erkenntnis ist besonders wichtig, um die eigene Leistungsfähigkeit und die Verbindung zu den eigenen Bedürfnissen wiederherzustellen. Mein Anliegen ist es, die Raum für die menschlichen Aspekte der Funktionsweise in unserer modernen Welt zu schaffen und darauf hinzuweisen, dass es in Ordnung ist, nicht immer perfekt zu funktionieren. Manchmal müssen wir einfach innehalten und uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. So trete ich in die zweite Staffel mit dem Bewusstsein ein, dass Fehler, Pausen und das Verfolgen intuitiver Bedürfnisse ganz normal und notwendig sind.

🎆 Staffel 1 Finale
27.12.2025 | 22 Min.
In dieser letzten Episode des Jahres blicke ich auf die Entwicklung des Podcasts zurück und teile meine Gedanken zur genauen Ausrichtung und den Herausforderungen, die ich während des Jahres erlebt habe. Ich betrachte das Jahr in seiner Gesamtheit, das mit dem Fokus auf Neurodiversität begann und sich durch verschiedene Themen und Formate bewegte. Während ich über die Feiertage reflektierte, wurde mir klar, dass ich zu den zentralen Themen wie ADHS, Autismus und komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen zurückkehren möchte, um diesen wichtigen Diskurs in der neuen Staffel zu vertiefen. Ich habe bemerkt, dass ich, abgesehen von den ursprünglichen Inhalten, eher episodische Experimente und Rückblicke gemacht habe, die nicht den Kern der Hörerschaft ansprächen. Dies hat mir eindeutig gezeigt, dass die Zuschauer eine klare und konzentrierte Herangehensweise an die Themen erwarten. Auch wenn es erfrischend war, verschiedene Formate auszuprobieren, möchte ich im nächsten Jahr die Episoden strukturierter gestalten. Mein Ziel ist es, qualitativ hochwertige und thematisch dichter gefasste Folgen anzubieten, ohne mich zu sehr hetzen zu müssen. Im Rückblick auf die technischen Herausforderungen, die ich mit der Produktion hatte, kann ich festhalten, dass ich durch unerwartete Probleme viel über den Produktionsprozess gelernt habe. Zum Beispiel gab es Missverständnisse bei der Audioqualität und der Bereitstellung von Inhalten, die sehr lehrreich waren. Diese Erfahrungen haben mir auch bewusst gemacht, dass weniger oft mehr ist und dass ich den Podcast authentisch halten möchte, anstatt unter Druck zu stehen, mit übermäßig komplizierten Formaten zu experimentieren. Daher werde ich versuchen, es im kommenden Jahr einfacher zu halten und regelmäßige, kleinere Episoden zu produzieren. Ein zukunftsweisendes Thema, das ich in der neuen Staffel aufgreifen möchte, ist das Konzept des "funktionalen Menschen". Es geht darum, wie Menschen innerhalb der Gesellschaft bewertet werden – nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch im Kontext der Erwartungen, die die Gesellschaft an uns stellt. Diese Perspektive könnte interessante Diskussionen über die Anforderungen an Neurodivergente und die Art und Weise, wie sie in verschiedenen Lebensbereichen wahrgenommen werden, eröffnen. So wie wir uns auf den Jahreswechsel zubewegen, reflektiere ich über die Herausforderungen und Krisen, die wir als Gesellschaft bewältigen, und hoffe, dass die kleinen Fragen und Probleme – wie die Verzögerung einer Podcast-Episode – im Vergleich zu den größeren Herausforderungen der Welt unbedeutend erscheinen. Ich lade die Hörer ein, mit mir in das neue Jahr zu starten und die Entwicklungen des Podcasts in der zweiten Staffel zu verfolgen, die hoffentlich noch konstanter und fokussierter sein wird.

🎁🎵 MONSTRAMOR - Ein psychologisches Winteroratorium - Die Reise zum inneren Kind
24.12.2025 | 1 Std. 4 Min.
🎁🎵 MONSTRAMOR - Ein psychologisches Winteroratorium - Die Reise zum inneren Kind

🎄🎙️4.Advent – Die große Weihnachtsshow (für Neurodivergente)
20.12.2025 | 2 Std. 39 Min.
In dieser Episode von Evomentis feiere ich den vierten Advent mit einer besonderen Weihnachtsshow, die voller Musikalität und unperfekter Freude steckt. Ich zünde ein Feuer an und lade dich ein, diese festliche Atmosphäre zu genießen, während wir uns auf das bevorstehende Weihnachten einstimmen. Diese Episode ist anders als gewohnt – sie ist länger und bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Geschichten, Weihnachtssongs und amüsanten Betrachtungen rund um die Feiertage. Wir lassen den strengen Weihnachtsdruck hinter uns und zelebrieren stattdessen die humorvolle und entspannte Seite der Festtage. Begleitet von weihnachtlicher Musik – sowohl klassischer als auch origineller Melodien – führen wir ein wenig durch die Weihnachtsgeschichte und beleuchten einige skurrile Fakten über Weihnachten, die viele von uns vielleicht nicht kennen. Ich habe auch einen Blick auf alternative, unkonventionelle Weihnachtsmusik geworfen und teile eine Spotify-Playlist mit, damit du die neuesten musikalischen Entdeckungen auch direkt hören kannst. Ein zentraler Teil der Episode widmet sich der Weihnachtsgeschichte um Maria und Josef. Ich stelle die traditionellen Erzählungen in Frage und bringe eine moderne Perspektive ein, die sich mit den historischen und theoretischen Aspekten der Geburtsgeschichte von Jesus auseinandersetzt. Dabei beleuchte ich auch interessante Theorien über die Beziehung zwischen den Hauptfiguren und hinterfrage die gesellschaftlichen Normen, die oft ungeprüft als gegeben hingenommen werden. Zusätzlich erfährst du von den Bräuchen rund um Weihnachten aus verschiedenen Kulturen, von der Weihnachtsgurke, die in den USA populär ist, bis hin zu den feierlichen Traditionen in Katalonien. Ich teile amüsante Anekdoten, die das Fest aus einem anderen Blickwinkel beleuchten und lade dich dazu ein, dir Gedanken über deine eigenen Weihnachtsrituale zu machen. Wir werfen auch einen kritischen Blick auf die Figur des Weihnachtsmannes und die damit verbundenen Mythen. Ist der Weihnachtsmann wirklich nur ein dicker, weißer Mann mit einer roten Mütze? Ich stelle die gängigen Stereotypen in Frage und erkunde, welche anderen Darstellungen von Weihnachten erdenklich wären. Die Episode bietet einen bunten Mix aus Humor, skurrilen Geschichten und tiefgründigen Überlegungen, die dich letztlich in eine nachdenkliche und frohe Weihnachtszeit entlassen wollen. Mit einem Feuerchen im Hintergrund, fröhlicher Musik und vielen kleinen Geschichten lade ich dich ein, dich zurückzulehnen, die letzte Vorbereitungen für die Feiertage zu genießen und vielleicht in die eigene Kindheit und die Freuden von Weihnachten einzutauchen – ganz unperfekt und voller Freude.

🎄🎙️4.Advent – Die große Weihnachtsshow (für Neurodivergente)
20.12.2025 | 2 Std. 39 Min.
In dieser Episode von Evomentis feiere ich den vierten Advent mit einer besonderen Weihnachtsshow, die voller Musikalität und unperfekter Freude steckt. Ich zünde ein Feuer an und lade dich ein, diese festliche Atmosphäre zu genießen, während wir uns auf das bevorstehende Weihnachten einstimmen. Diese Episode ist anders als gewohnt – sie ist länger und bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Geschichten, Weihnachtssongs und amüsanten Betrachtungen rund um die Feiertage. Wir lassen den strengen Weihnachtsdruck hinter uns und zelebrieren stattdessen die humorvolle und entspannte Seite der Festtage. Begleitet von weihnachtlicher Musik – sowohl klassischer als auch origineller Melodien – führen wir ein wenig durch die Weihnachtsgeschichte und beleuchten einige skurrile Fakten über Weihnachten, die viele von uns vielleicht nicht kennen. Ich habe auch einen Blick auf alternative, unkonventionelle Weihnachtsmusik geworfen und teile eine Spotify-Playlist mit, damit du die neuesten musikalischen Entdeckungen auch direkt hören kannst. Ein zentraler Teil der Episode widmet sich der Weihnachtsgeschichte um Maria und Josef. Ich stelle die traditionellen Erzählungen in Frage und bringe eine moderne Perspektive ein, die sich mit den historischen und theoretischen Aspekten der Geburtsgeschichte von Jesus auseinandersetzt. Dabei beleuchte ich auch interessante Theorien über die Beziehung zwischen den Hauptfiguren und hinterfrage die gesellschaftlichen Normen, die oft ungeprüft als gegeben hingenommen werden. Zusätzlich erfährst du von den Bräuchen rund um Weihnachten aus verschiedenen Kulturen, von der Weihnachtsgurke, die in den USA populär ist, bis hin zu den feierlichen Traditionen in Katalonien. Ich teile amüsante Anekdoten, die das Fest aus einem anderen Blickwinkel beleuchten und lade dich dazu ein, dir Gedanken über deine eigenen Weihnachtsrituale zu machen. Wir werfen auch einen kritischen Blick auf die Figur des Weihnachtsmannes und die damit verbundenen Mythen. Ist der Weihnachtsmann wirklich nur ein dicker, weißer Mann mit einer roten Mütze? Ich stelle die gängigen Stereotypen in Frage und erkunde, welche anderen Darstellungen von Weihnachten erdenklich wären. Die Episode bietet einen bunten Mix aus Humor, skurrilen Geschichten und tiefgründigen Überlegungen, die dich letztlich in eine nachdenkliche und frohe Weihnachtszeit entlassen wollen. Mit einem Feuerchen im Hintergrund, fröhlicher Musik und vielen kleinen Geschichten lade ich dich ein, dich zurückzulehnen, die letzte Vorbereitungen für die Feiertage zu genießen und vielleicht in die eigene Kindheit und die Freuden von Weihnachten einzutauchen – ganz unperfekt und voller Freude.
Weitere Bildung Podcasts
Trending Bildung Podcasts
Über EVOMENTIS - Neurodiversität, ADHS, Autismus und darüber hinaus
Höre EVOMENTIS - Neurodiversität, ADHS, Autismus und darüber hinaus, Gehirn gehört - Prof. Dr. Volker Busch und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App

Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen


EVOMENTIS - Neurodiversität, ADHS, Autismus und darüber hinaus
App laden,
loshören.