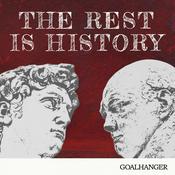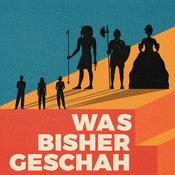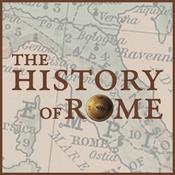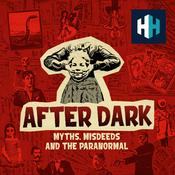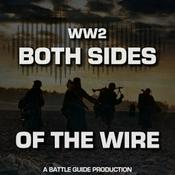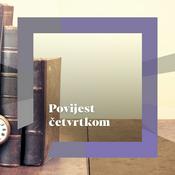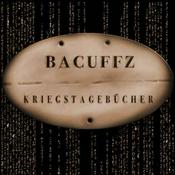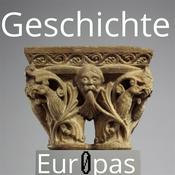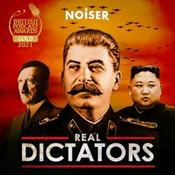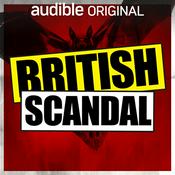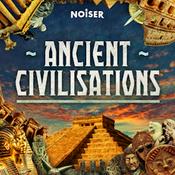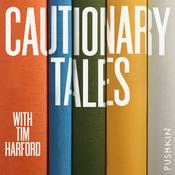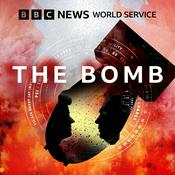47 Episoden
- Mit Julia Burkhardt:
Als Sigismund 1411 König wurde, war er 43 Jahre alt. Ein bewegtes Leben lag bereits hinter ihm. Seit 24 Jahren war er König von Ungarn und hatte gelernt sich machtpolitisch durchzusetzen.
Als römisch-deutscher König stellte er sich der Aufgabe, das große Schisma, also die Teilung der Kirche unter drei Päpste, zu überwinden.
Sigismund lud im November 1414 Vertreter der gesamten Christenheit zum Konzil nach Konstanz. Schätzungsweise waren es mehr als 50.000 Konzilsteilnehmer, die in die kleine Stadt am Bodensee strömten. 33 Kardinäle, 300 Bischöfe, 500 Äbte, Heerscharen von Gelehrten, Unterhändlern und Bodyguards. Sogar 700 Prostituierte wurden offiziell registriert. Die 50.000 Menschen blieben jahrelang. Konstanz war für diesen Andrang gar nicht geschaffen.
4 Jahre dauerte der Ausnahmezustand am Bodensee. Eine bewegte Verhandlungszeit. Der Papst aus Pisa floh nach 5 Monaten verkleidet als Stallknecht nach Freiburg. Der Papst aus Rom trat freiwillig zurück und der aus Avignon wurde abgesetzt. Damit war der Weg für eine neue Papstwahl frei. Die fand gleich in Konstanz am Hafen statt. Das Gebäude steht heute immer noch. Ein Warenlager funktionierte man zum Konklave um und einigte sich endlich auf nur einen Papst: Martin V. Das große Schisma war beendet. 7 Jahre nach seiner Königswahl hatte Sigismund sein Ziel erreicht. Er war auf dem Höhepunkt seiner Macht.
Umso erstaunlicher, dass das Schicksal eines einfachen tschechischen Predigers, das restliche Leben von Sigismund dominieren sollte. Die Kirche machte dem Reformgelehrten Jan Hus während des Konzils in Konstanz den Prozeß. Jan Hus starb auf dem Scheiterhaufen, obwohl König Sigismund ihm freies Geleit zugesichert hatte. Daraufhin brachen in Böhmen die Hussitenkriege aus, die Sigismund und die Reichspolitik Jahrzehnte in Atem hielten.
Ich spreche mit der Julia Brukhardt, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, über den zupackenden König- und Kaiser und die Voraussehbarkeit der Revolte in Böhmen.
Die Reisetipps und viele Bilder findet Ihr hier:
www.99xgeschichte.de
Das Goethe-Institut bietet diese Podcastserie auf seiner Plattform "Deutschstunde" an.
"Wer wir sind und warum das nicht klappte..." ist Teil der Netzwerke Wissenschaftspodcasts.de, #Historytelling und Mittelalter.digital.
#Mittelalter #Deutschland # Westeuropa #Europa - Mit Christian Oertel
Der römisch deutsche König Wenzel hält den Rekord an übler Nachrede unter den Königen und Kaisern in der deutschen Geschichte. Wenzel, der Sohn von Karl IV., regierte 22 Jahre lang das römisch-deutsche Reich. Zumindest sah er das so. Die Kurfürsten waren anderer Meinung und setzen Wenzel nach 22 Jahren ab. Wegen Untätigkeit. Sie nannten ihn „unwürdig“ und „unnütz“. Eine beispiellose Demütigung. Zusätzlich verunglimpfte ihn der Papst. Wenzel hätte nicht nur einen verdorbenen Charakter, sondern sei weitgehend untätig geblieben, schrieb er 50 Jahre nach Wenzels Tod. Mit dem vernichtenden Urteil des Papstes bekam Wenzel in der Geschichtsschreibung den Beinnamen: „der Faule“.
Schon zu seinen Lebzeiten häuften sich Horrogeschichten von Peitschen und Kampfhunden mit denen er auf Untergebene losgegangen sein soll. Er habe Löwen zur Einschüchterung seiner Gegner gehalten, Reliquien zerstört und Prag angezündet. Dabei wäre er der Völlerei und der Trunksucht verfallen.
Doch was ist dran an den Vorwürfen? Sie alle haben eines gemeinsam: Sie stammen von seinen Gegnern. Der Papst verachtete ihn, weil Wenzel als König von Böhmen den Reformator Jan Hus unterstützte. Wenzel selber kümmerte sich nicht um breitenwirksame Gegen-PR sondern ließ erlesene Prachthandschriften herstellen, die seine Königswürde beweisen sollten.
Vielleicht war er kein "natural born leader" sagt der Historiker Christian Oertel, aber ganz so schlimm, wie ihn seine Gegner zeichneten, wird er wohl nicht gewesen sein. Im Gegenteil: Vielleicht war er seinen Zeitgenossen in manchen Punkten seiner Herrschaftspraxis einfach weit voraus...
Die Reisetipps und viele Bilder findet Ihr hier:
www.99xgeschichte.de
Das Goethe-Institut bietet diese Podcastserie auf seiner Plattform "Deutschstunde" an.
"Wer wir sind und warum das nicht klappte..." ist Teil der Netzwerke Wissenschaftspodcasts.de, #Historytelling und Mittelalter.digital.
#Mittelalter #Deutschland # Westeuropa #Europa - Mit Gregor Rohmann:
Was bleibt von Klaus Störtebeker und der Seeräuberromantik des Mittelalters, wenn man zeitgenössische Quellen erforscht? Darüber sprechen wir heute.
Die Vitalienbrüder waren Gewaltunternehmer zur See und keine sozialromantischen Freibeuter sagt Gregor Rohmann, Professor für die regionale Kulturgeschichte Mecklenburgs in Rostock. Jede Konfliktpartei auf der Ostesee konnte sie engagieren. Die dänische Königin genauso, wie die Meckelnburger Herzöge oder die Hanse. Die Vitalienbrüder wechselten oft die Seiten. In einer Zeit ohne wirksames Gewaltmonopol waren sie legitime Unterstützer zur Durchsetzung des privaten Rechts. So jedenfalls, sah der jeweilige Auftraggeber seine Mitkombattanten. Für die jeweiligen Gegner waren die Vitalienbrüder meistens die "Piraten".
Erst durch die Geschichtsschreibung entsteht die Legende von Klaus Störtebeker, dem legendären Anführer. Gregor Rohmann erforscht seit Jahrzehnten die zeitgenössischen Quellen und fand keinen Hinweis auf einen "Klaus" Störtebeker im Zusammenhang mit den Söldnern zur See. Vielleicht war "Johannes" Störtebeker aus Danzig gemeint. Der wurde allerdings nie hingerichtet sondern am Ende seines Lebens, friedlich in Rostock eingebürgert.
Über die Fahndung nach Klaus Störtebker und was wir heute gesichert über die Vitalienbrüder wissen, darüber spreche ich mit dem Historiker Gregor Rohmann in dieser Episode.
Die Reisetipps und viele Bilder findet Ihr hier:
www.99xgeschichte.de
Das Goethe-Institut bietet diese Podcastserie auf seiner Plattform "Deutschstunde" an.
"Wer wir sind und warum das nicht klappte..." ist Teil der Netzwerke Wissenschaftspodcasts.de, #Historytelling und Mittelalter.digital.
#Mittelalter #Deutschland # Westeuropa #Europa - Mit Angela Huang:
Die Hanse war das größte Europäische Handelsnetzwerk im Mittelalter. Es erstreckte sich über den ganzen Ostseeraum und darüber hinaus. Die Hanse hatte Niederlassungen in Russland, Norwegen, London und Brügge. Den ersten Hansetag, das Treffen aller aktuellen Mitglieder der Hanse, datieren wir ins Jahr 1358. Auch nach 668 Jahren ist sie bis heute in vielen Fragen eine Black Box. Die Hanse führte kein Mitgliederverzeichnis. Es war nie ganz klar, wer außer Lübeck, Köln und Hamburg gerade mit an Bord war. Auch Paderborn, Soest oder Magdeburg gehörten ihr zeitweise an. Aber seit wann und wie lange? Kein Mitgliederverzeichnis, keine Angestellten und sowieso kein Organigramm...Und trotzdem wurde sie die Hanse die mächtigste Handelsorganisation des Mittelalters.
Ich spreche mit Dr. Angela Huang, der Leiterin der Forschungsstelle zur Geschichte der Hanse und des Ostseeraums am Europäischen Hansemuseum in Lübeck. Was war das Erfolgsrezept der verschwiegenen Kaufleute und warum hielt ihr Ostseemonopol 300 Jahre lang?
Das alles und wie jeder von uns sich an der aktuellen Hanseforschung beteiligen kann, hört ihr in dieser Folge.
Den link zum citizen science Projekt, die Reisetipps und viele Bilder findet Ihr hier:
www.99xgeschichte.de
Das Goethe-Institut bietet diese Podcastserie auf seiner Plattform "Deutschstunde" an.
"Wer wir sind und warum das nicht klappte..." ist Teil der Netzwerke Wissenschaftspodcasts.de, #Historytelling und Mittelalter.digital.
#Mittelalter #Deutschland # Westeuropa #Europa - Mit Eva Schlotheuber: Karl IV. war hoch arlamiert:
"Besonders Du, Mißgunst, hast das christliche Kaisertum (…) mit dem altbösen Gift, das Du wie eine Schlange in verbrecherischer Untat auf die Zweige des Reiches und seine nächsten Glieder gespritzt hast, um nach Einsturz der Säulen das ganze Gebäude als Ruine zusammenstürzen zu lassen - so hast Du also mannigfach Spaltung unter die sieben Kurfürsten des Heiligen Reiches gebracht (…) durch die das Heilige Reich erleuchtet werden soll.“ So beginnt der Text der Goldenen Bulle.
Karl IV. fürchtete den Kollaps des römisch-deutschen Reiches. Zerrieben zwischen den Interessen der Päpste und der Kurfürsten. Deshalb verhandelte und verfasste er die "Goldene Bulle". Das erste Grundgesetz des römisch-deutschen Reiches. Karl IV. schaffte es, die Mitspracheansprüche der Päpste bei Königswahlen zurückzudrängen und die Kurfürsten zur Einigkeit zu verpflichten. Ein Meisterstück der Diplomatie.
Ich spreche mit Eva Schlotheuber, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Uni Düsseldorf, über Karls hartnäckige Verhandlungen zur Entstehung der Goldenen Bulle und ihre jahrhundertelange Bedeutung für das Reich.
Ihre Reisetipps und viele Bilder findet Ihr hier:
www.99xgeschichte.de
Das Goethe-Institut bietet diese Podcastserie auf seiner Plattform "Deutschstunde" an.
"Wer wir sind und warum das nicht klappte..." ist Teil der Netzwerke Wissenschaftspodcasts.de, #Historytelling und Mittelalter.digital.
#Mittelalter #Deutschland # Westeuropa #Europa
Weitere Geschichte Podcasts
Trending Geschichte Podcasts
Über Wer wir sind und warum das nicht klappte ...
Die deutsche Geschichte vom Neandertaler bis Angela Merkel. Die Podcastserie reist in 99 Folgen durch die deutsche Geschichte. Du lernst spannende Orte und Expertinnen kennen und bekommst den Überblick über das, was war.
Podcast-WebsiteHöre Wer wir sind und warum das nicht klappte ..., Alles Geschichte - Der History-Podcast und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App
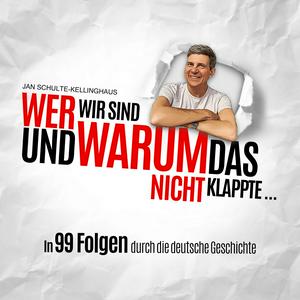
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen

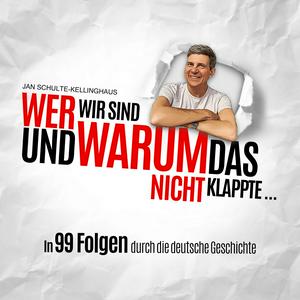
Wer wir sind und warum das nicht klappte ...
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.