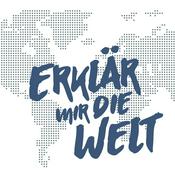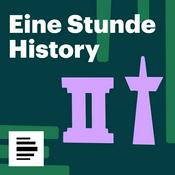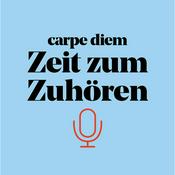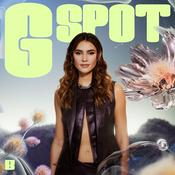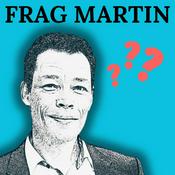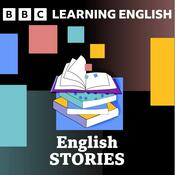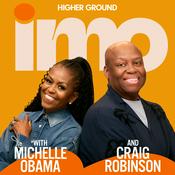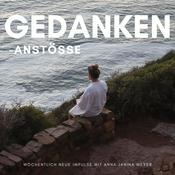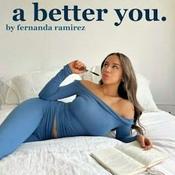50 Episoden

Grundsatz #50 – Mit Zuversicht durch Krisen – mit Wolfgang Schüssel
17.6.2025 | 1 Std. 7 Min.
In der mittlerweile 50. Folge von Grundsatz spricht Moderator Gerhard Jelinek mit dem ehemaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel über dessen neues Buch „Zuversicht“. Im Zentrum steht die Frage, wie man angesichts von Klimakrise, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit Hoffnung bewahren und zugleich verantwortungsvoll handeln kann. Schüssel, selbst geprägt von seiner Kindheit in der Nachkriegszeit, sieht die positive Entwicklung Österreichs als Beleg dafür, dass Fortschritt möglich ist – durch Innovation, Zusammenarbeit und Mut. Besonderen Fokus legt Schüssel auf Forschung, Technologie und eine handlungsfähige europäische Gemeinschaft. Fortschritt dürfe nicht durch Angst oder Verbote blockiert, sondern müsse aktiv gestaltet werden. Gerade in Sicherheits- und Verteidigungsfragen brauche es mehr europäische Kooperation. Ebenso fordert er eine politische Kultur, die weniger polarisiert und stärker auf sachliche, inhaltliche Debatten setzt. Rückblickend spricht er offen über Entscheidungen seiner Amtszeit – von der Koalition mit der FPÖ bis zur Eurofighter-Debatte – und appelliert, politische Verantwortung mit Weitblick zu übernehmen. Zum Abschluss wird das Grundsatz-Gespräch persönlich. Schüssel spricht über Werte wie Hoffnung, Liebe und Verantwortung – sowohl im privaten als auch im politischen Leben. Politik müsse Menschen ermutigen, statt sie zu entmutigen. Seine zentrale Botschaft: In Krisenzeiten braucht es Führungspersönlichkeiten und Institutionen, die Orientierung geben – mit Klarheit, Zuversicht und Haltung.

Grundsatz #49 Viktor Frankl und die Politik zwischen Sinn, Freiheit und Haltung – mit Alexander Vesely-Frankl und Gudrun Kugler
20.5.2025 | 41 Min.
In der 49. Folge von Grundsatz spricht Gerhard Jelinek mit Alexander Vesely-Frankl, dem Enkel von Viktor Frankl, und der Nationalratsabgeordneten Gudrun Kugler über die Frage, was Freiheit heute bedeutet – besonders in einer Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung suchen und unter psychischem Druck stehen. Dabei geht es vor allem um die Lehren der Logotherapie. Vesely erklärt, dass wir zwar nicht alle Umstände unseres Lebens beeinflussen können, aber immer die Freiheit haben, wie wir damit umgehen. Im Gespräch wird deutlich, dass Freiheit nicht bloß Unabhängigkeit bedeutet, sondern mit Verantwortung einhergeht. Im Gespräch erinnert Gudrun Kugler an eine Rede von Viktor Frankl aus dem Jahr 1988, in der er davor warnte, dass nicht jedes Mittel durch ein gutes Ziel gerechtfertigt werden darf. Sie betont, dass Politik nicht nur Ziele verfolgen, sondern auch darauf achten müsse, wie diese erreicht werden. Wichtig sei außerdem, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, die Menschen dazu ermutigen, selbst Verantwortung zu übernehmen – zum Beispiel durch Zugang zu Bildung, Sicherheit oder einer guten digitalen Infrastruktur. Statt Menschen abhängig zu machen, solle Politik ihnen helfen, eigenständig zu leben. Beide Gäste sehen den starken Anstieg psychischer Erkrankungen als Hinweis darauf, dass vielen Menschen ein tieferer Lebenssinn fehlt. Politik könne diesen Sinn nicht vorgeben, aber sie kann Möglichkeiten schaffen, in denen Menschen ihren eigenen Weg finden. Freiheit brauche nicht nur Raum, sondern auch Haltung – und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und für andere.

Grundsatz #48 Unsere Grundwerte sind unser Kompass – 80 Jahre Volkspartei mit Michael Spindelegger, Josef Pröll, Wilhelm Molterer und Sebastian Kurz
17.4.2025 | 54 Min.
Anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Österreichischen Volkspartei widmet sich die 48. Folge des Podcasts Grundsatz einer besonderen Rückschau und zugleich einem Blick in die Zukunft. Moderator Gerhard Jelinek spricht mit vier ehemaligen Parteiobmännern – Michael Spindelegger, Josef Pröll, Wilhelm Molterer und Sebastian Kurz – über die Gründung der ÖVP im April 1945 und die nachhaltige Bedeutung ihrer 15 Gründungsgrundsätze. Die Gespräche kreisen um zentrale Werte wie Freiheit, Leistung, Solidarität und Demokratie, die bereits vor der Wiedererrichtung der Republik formuliert wurden und bis heute den Markenkern der Partei prägen. Im Zentrum dieser Episode steht die Frage, wie tragfähig die ursprünglichen Prinzipien der ÖVP im politischen Alltag von heute noch sind. Michael Spindelegger sieht die Wiederherstellung einer fairen Balance zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung als entscheidend an – besonders in Zeiten zunehmender Regulierung und sozialen Drucks. Josef Pröll verweist auf den soliden marktwirtschaftlichen Grundsatz und dass es von Anfang an die Absicht der Volkspartei war, das Land nachhaltig zu entwickeln. Zudem unterstreicht Wilhelm Molterer die Relevanz von Grundwerten wie Leistung und Solidarität, die eine Gesellschaft nur dann tragen können, wenn Rechte und Pflichten in einem gerechten Verhältnis stehen. Sebastian Kurz hebt schließlich hervor, dass Eigenverantwortung und ein starker Wirtschaftsstandort nicht nur ideologische Leitlinien, sondern zentrale Pfeiler für zukunftsgerichtete Politik seien. Alle vier ehemaligen Parteiobmänner betonen, dass Prinzipientreue und Veränderungsbereitschaft keine Widersprüche sein dürfen – sondern gemeinsam die Stärke einer modernen Volkspartei ausmachen. Aus den Gesprächen geht hervor, dass die Grundsätze der ÖVP nicht als starre Tradition, sondern als Kompass verstanden werden müssen, der gerade in einer Zeit gesellschaftlicher Verunsicherung, digitaler Umbrüche und internationaler Krisen Orientierung bieten kann. Stabilität und Verlässlichkeit müssten inhaltlich verankert bleiben, um glaubwürdige Politik zu ermöglichen. Insbesondere die Balance zwischen individueller Freiheit und dem Gemeinwohl wird dabei von den ehemaligen Parteiobmännern als zentrale Herausforderung der Gegenwart gesehen. Trotz unterschiedlicher politischer Epochen und Koalitionen eint die vier Gesprächspartner die Überzeugung, dass die ÖVP über Jahrzehnte hinweg ein wesentlicher Stabilitätsanker in Österreich war. Der Anspruch, Volkspartei zu sein, verpflichtet heute mehr denn je zu inhaltlicher Klarheit, Prinzipientreue und struktureller Erneuerung – damit die Partei auch in Zukunft Orientierung für Wählerinnen und Wähler geben kann.

Grundsatz #47 Warum Integration nicht nur gefordert sondern auch gefördert werden muss – mit Karl Mahrer und Hasnain Kazim
08.4.2025 | 44 Min.
In dieser Episode von Grundsatz dreht sich das Gespräch um Migration, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Moderator Gerhard Jelinek diskutiert mit dem Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Karl Mahrer und dem Journalisten und Autor Hasnain Kazim über die Herausforderungen von Zuwanderung und Integration in Österreich und Europa. Ein zentrales Thema dieser Folge ist die Frage, wie Integration erfolgreich gestaltet werden kann. Während Hasnain Kazim betont, dass Integration eine bewusste politische Steuerung erfordere, hebt Karl Mahrer hervor, dass Integration nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden müsse. Dabei wird die Rolle von Sprache, Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe als wesentliche Faktoren für eine gelungene Integration hervorgehoben. Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion liegt auf der öffentlichen Wahrnehmung von Migration und den dominierenden Narrativen in Politik und Medien. Dabei wird auch diskutiert, welchen Einfluss populistische Strömungen auf den Migrationsdiskurs haben und ob eine sachliche Debatte in der aktuellen politischen Landschaft noch möglich ist. Während Kazim für einen offeneren Diskurs plädiert, fordert Mahrer eine klare politische Linie, um konstruktive Lösungen anzubieten. Schließlich thematisieren die Gesprächspartner die gesellschaftlichen Spannungen, die durch Migration entstehen können, und beleuchten die Interaktion verschiedener Communities in Wien. Sie diskutieren, welche politischen Maßnahmen notwendig sind, um Konflikte zu vermeiden und ein friedliches Zusammenleben zu fördern. Dabei werden sowohl die Herausforderungen der vergangenen Jahre als auch Lösungsansätze für die Zukunft besprochen.

Grundsatz #46 Deutschland nach der Bundestagswahl – Folgen für die politische Mitte und Europas Stabilität - mit Sebastian Enskat und Michael Mehler
28.2.2025 | 35 Min.
In der 46. Episode von „Grundsatz“ spricht Moderator Gerhard Jelinek mit Sebastian Enskat, dem Leiter des Wiener Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, über die Ergebnisse der deutschen Bundestagswahl und deren weitreichende Folgen für Deutschland und Europa. Die Diskussion dreht sich um das Ende der Ampel-Koalition, den Wahlerfolg der CDU/CSU und die Herausforderungen, vor denen Friedrich Merz als möglicher zukünftiger Bundeskanzler steht. Dabei werden insbesondere die strukturellen Veränderungen in der Parteienlandschaft sowie die politische und gesellschaftliche Dynamik, die zum Wahlausgang geführt haben, analysiert.Ein zentrales Thema der Folge ist der schwindende Einfluss der politischen Mitte in Europa und das Erstarken der politischen Ränder. Enskat erläutert, dass populistische Parteien sowohl am rechten als auch am linken Rand zunehmend an Bedeutung gewinnen und damit die traditionelle Mitte-Parteien unter Druck setzen. Diese Entwicklung führe zu einer Fragmentierung des Parteiensystems und mache die Regierungsbildung zunehmend schwieriger.Neben der innenpolitischen Analyse beleuchten die Gesprächspartner auch die geopolitische Lage Europas. Die USA unter Donald Trump, China und Russland setzen Europa zunehmend unter Druck, während sich das politische Zentrum des Kontinents geschwächt und führungslos präsentiere. Enskat betont, dass Deutschland angesichts dieser Herausforderungen eine zentrale Führungsrolle übernehmen müsse, insbesondere im Bereich der Sicherheitspolitik und der europäischen Zusammenarbeit. Nur durch eine stärkere strategische Positionierung könne Europa in einer zunehmend unsicheren Welt bestehen.Die Folge endet mit einem klaren Appell an die Parteien der Mitte: Sie müssen selbstbewusster auftreten, klare Positionen beziehen und populistischen Vereinfachungen entschieden entgegentreten. Trotz der angespannten politischen Lage betont Enskat, dass Optimismus und eine konstruktive Auseinandersetzung mit den aktuellen Herausforderungen essenziell für die Zukunft der Demokratie seien.
Weitere Bildung Podcasts
Trending Bildung Podcasts
Über Grundsatz
Höre Grundsatz, {ungeskriptet} - Gespräche, die dich weiter bringen und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App

Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen


Grundsatz
App laden,
loshören.