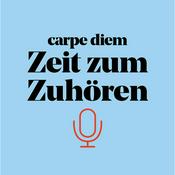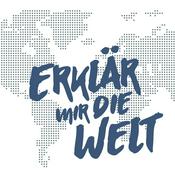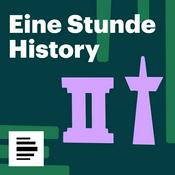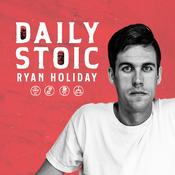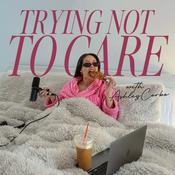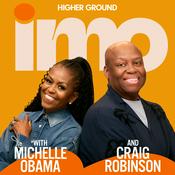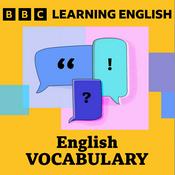35 Episoden
- Der frühere EU-Politiker Othmar Karas, die Sozialethikerin Linda Kreuzer, die Juristin Leokadia Grolmus, der Filmemacher Sebastian Bobik und der Journalist Christian Rathner diskutierten beim "ksœ-Forum" über den Zusammenhang von sozialem Frieden und Verständigung.
Wie transportiert man konfliktfrei zwei Millionen Menschen am Tag, Anna Maria Reich-Kellnhofer?
01.12.2025 | 31 Min."Wenn in einem U-Bahnzug, wo 900 Menschen reinpassen, plötzlich so ein vereintes Lächeln ist: das sind meine Magic Moments bei den Wiener Linien."
Rund 2,4 Millionen Menschen fahren täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Wiener Linien; manche davon wahrscheinlich grantig, mit Sorgen oder im Stress. Trotzdem verläuft die tägliche Öffi-Reise in den meisten Fällen harmonisch. Wir fragen uns: Wie bringt man Menschen auf engem Raum zusammen, ohne dass Konflikte entstehen? Kann eine originelle Durchsage nicht nur erheitern, sondern auch deeskalieren? Und welche Überlegungen stecken dahinter? Wir sprechen mit Anna Maria Reich-Kellnhofer über die Kommunikation der Wiener Linien, deren Ziele und darüber, was funktionierender und konfliktarmer öffentlicher Verkehr mit sozialem Frieden zu tun hat.- Wir leben in Zeiten von „Bubbles“, dem Rückzug in Echokammern und dem Erstarken radikaler Strömungen. Dies schlägt sich auch europapolitisch nieder und Parteien wandern weiter an die Ränder bzw. ziehen sich in Nationalismus zurück – eine Gefahr für den sozialen Frieden. Doch wie kann der der gesellschaftliche Dialog und das Finden von gemeinsamen Nennern wieder gelingen, gerade über Nationalgrenzen hinweg? Wie entsteht Gemeinschaft zwischen Menschen, die weit voneinander entfernt leben? Wir sprechen mit Othmar Karas über seinen Blick auf Europa, die gesellschaftliche Mitte, „konstruktiven und konfrontativen Dialog“ und was ihm sozialer Friede politisch wie persönlich bedeutet.
- „Mir geht es bei Synodalität gar nicht so sehr darum, wer ‚vorne‘ oder ‚hinten‘ geht, sondern vielmehr um die Straße, den Weg, auf dem wir uns befinden. Unter Papst Franziskus war es wieder möglich, über Themen wie Geschlechterrollen, Frauenweihe oder Homosexualität zu sprechen, etwas, das früher mehr oder weniger tabuisiert war. Ich denke, es würde generell etwas zur Entkrampfung so mancher Kommunikation in unserer Gesellschaft führen, wenn wir das Prinzip der Synodalität öfter anwenden würden.“
Wir sprechen mit Bischof Josef Marketz über das Prinzip der Synodalität. Er erklärt den synodalen Weg als dialogische Entscheidungsfindungsmöglichkeit zwischen allen Beteiligten, unabhängig von ihrer Position in der kirchlichen Hierarchie. Außerdem thematisiert er, wie Synodalität auch außerhalb der Kirche angewandt werden kann und was ihm der synodale Weg persönlich bedeutet.
Weitere Bildung Podcasts
Trending Bildung Podcasts
Über Der Sozialkompass
Der Podcast über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege
Der Sozialkompass widmet sich aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und den Menschen, die dafür Orientierungsmöglichkeiten und Lösungswege bieten. Gemeinsam mit ihnen versucht er, mehr über die Voraussetzungen für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander zu erfahren. Einmal im Monat treffen Markus Schlagnitweit und Henning Klingen Personen aus Theorie und Praxis, um mit ihnen herauszufinden: „In welche Richtung kann es weitergehen?“
Podcast-WebsiteHöre Der Sozialkompass, carpe diem – Der Podcast für ein gutes Leben und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App

Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen


Der Sozialkompass
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.