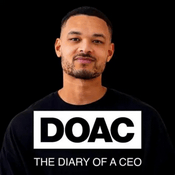12 Episoden
- Warum erzähle ich diese Geschichte?
Vielleicht, weil ein Schaf mir etwas gezeigt hat, das in unserer Zeit leicht verloren geht. Es war anders. Sichtbar anders. Kein Fell, kein Platz in der Herde, kein Schutz durch die Gruppe. Und doch wirkte es nicht verbittert, nicht rastlos, nicht unzufrieden. Es lebte für sich. Still. Unauffällig. Aber offenbar in Ordnung mit sich.
Wir reden oft von Zugehörigkeit, von Gemeinschaft, von Anpassung. Und selten davon, was es kostet, bei sich zu bleiben. Den eigenen Weg zu gehen. Den Trampelpfad zu verlassen.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit mutig.substack.com - Eigentlich hatte ich für diese Woche einen anderen Text geplant. Doch manchmal drängen sich Themen auf, die nicht warten wollen. In meinem Fall waren es die Gespräche und Vorträge vom World Economic Forum in Davos, die mich nicht mehr losgelassen haben. Nicht wegen einzelner Aussagen. Sondern wegen der Stimmung, die zwischen den Zeilen mitschwang.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit mutig.substack.com - Ich gebe zu, der Titel dieses Textes ist bewusst etwas provozierend gewählt. Nicht, um Aufmerksamkeit zu erzwingen, sondern weil er genau den Gedanken trifft, der mich seit Tagen nicht loslässt.
Ein Freund erzählte mir kürzlich von einem gemeinsamen Bekannten. Beruflich ist er extrem erfolgreich, ehrgeizig, fokussiert, diszipliniert. Einer, der sich Ziele setzt und sie erreicht. Nun hat er sich ein neues vorgenommen. Kein berufliches, kein wirtschaftliches – sondern ein sehr persönliches.
Er möchte in diesem Jahr allein mit seinem Motorsegler den Nordatlantik überqueren. Und als wäre das nicht genug, plant er bereits das nächste Abenteuer: die Nordwestpassage mit dem Segelboot. Eine Route durch eisige Gewässer, fernab jeder Zivilisation, fernab jeder schnellen Hilfe.
Das ist kein Sonntagsausflug. Keine sportliche Herausforderung im üblichen Sinn. Es ist eine Unternehmung, die reale Gefahren birgt: Kälte, Isolation, unberechenbares Wetter, technische Risiken. Eine Reise, die – nüchtern betrachtet – ein Leben kosten kann.
Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Ich kenne seine Beweggründe nicht. Aber ich gehe davon aus, dass ihm dieses Risiko vollkommen bewusst ist. Dass er weiß, worauf er sich einlässt. Und dass er trotzdem aufbricht.
Dieser Gedanke hat mich beschäftigt. Nicht das Abenteuer an sich. Nicht einmal der Mut, den es dafür braucht. Sondern die Bereitschaft, für ein solches Vorhaben im Zweifel mit dem eigenen Leben zu bezahlen.
Bereit zu sterben – für ein Abenteuer.
Die Faszination des Extremen
Die Geschichte dieses Bekannten steht nicht für sich allein. Sie reiht sich ein in eine lange Linie von Menschen, die bewusst dorthin aufbrechen, wo es kalt, einsam und gefährlich wird. In Gegenden, in denen Fehler ernsthafte Folgen haben und Hilfe keine Selbstverständlichkeit ist.
Bei solchen Unternehmungen denkt man schnell an historische Expeditionen. An Menschen wie Roald Amundsen, die in einer Zeit aufbrachen, in der eine Rückkehr eher Hoffnung war als Zusage. Wer damals loszog, wusste: Es kann gutgehen – muss es aber nicht.
Noch näher liegt für mich jedoch Reinhold Messner. Nicht als Held, nicht als Abenteuermarke, sondern als jemand, der immer offen davon gesprochen hat, dass man am Berg sterben kann. Und dass genau dieses Wissen Teil der Entscheidung ist. Kein Ausblenden, kein Schönreden. Sondern Klarheit darüber, was auf dem Spiel steht.
Was diese Menschen verbindet, ist weniger der Wunsch nach Ruhm oder Aufmerksamkeit. Es geht nicht um Unterhaltung oder Ablenkung. Es geht um etwas sehr Konkretes. Um das Erleben der eigenen Grenze. Um die Erfahrung, ob man mit sich selbst zurechtkommt, wenn Sicherheiten wegfallen. Für viele ist diese Art von Herausforderung kein Zusatz zum Leben, sondern etwas, das sie brauchen, damit es sich für sie richtig anfühlt.
Von außen werden solche Menschen schnell als Spinner bezeichnet. Als lebensmüde oder verantwortungslos. Wer genauer hinschaut, sieht oft das Gegenteil. Akribische Vorbereitung. Wochen, manchmal Monate des Planens, Trainierens, Durchdenkens. Und wenn sie dann unterwegs sind, handeln sie aufmerksam, konzentriert, nüchtern. Keine Romantik. Kein Leichtsinn.
In solchen Situationen sind sie ganz bei der Sache. Nicht im Sinne von „jeden Moment auskosten“, wie man es oft liest. Sondern ganz praktisch. Weil es keine Alternative gibt. Extreme Unternehmungen lassen wenig Spielraum. Man kann nicht nebenbei etwas anderes machen. Man kann sich nicht ablenken. Der Körper ist gefordert, der Kopf muss klar bleiben, Entscheidungen müssen getroffen werden. Alles andere rückt automatisch in den Hintergrund.
Der normale Alltag funktioniert anders. Er ist strukturiert, organisiert, gut abgesichert. Und genau darin liegt auch seine Kehrseite. Wir leben heute bequemer und sicherer als frühere Generationen. Und trotzdem fühlen sich viele innerlich zerstreut. Man ist ständig beschäftigt, aber selten wirklich bei einer Sache. Gedanken springen, Aufmerksamkeit verteilt sich auf zu viele Dinge gleichzeitig.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass manche Menschen dort Klarheit finden, wo das Leben auf eine schmale Spur reduziert wird. Wo man sich nicht verstecken kann. Wo Entscheidungen nicht theoretisch bleiben, sondern spürbare Folgen haben.
Nicht, weil sie den Tod suchen. Sondern weil sie diese Form von Herausforderung für ihr gutes Leben brauchen.
Meine persönliche Einstellung
Auch ich brauche Herausforderungen. Ich gehe Risiken ein. Und bei fast allem, was wir tun, schwingt ein gewisses Risiko mit. Selbst dann, wenn wir zu Fuß unterwegs sind oder ins Auto steigen. Die Möglichkeit, nicht zurückzukehren, ist real und gehört zum Leben dazu, ob wir darüber nachdenken oder nicht.
Trotzdem wäre ich nicht bereit, für ein solches Abenteuer mein Leben bewusst aufs Spiel zu setzen. Ich kann mir vorstellen, eine Woche zu Fuß durch Österreich zu gehen, alleine. Ich kann mir auch vorstellen, mit dem Kajak auf europäischen Flüssen unterwegs zu sein. Aber was ich persönlich brauche – zumindest nach heutigem Gefühl – ist ein Sicherheitsnetz. Die Möglichkeit, Hilfe zu holen, wenn etwas Unvorhersehbares passiert.
Das hat für mich wenig mit Angst zu tun. Es ist eher eine Frage der eigenen Art. Ich glaube, mir fehlt die innere Anlage für diese Form des Extremen. Und das ist in Ordnung. Jeder von uns bringt andere Eigenschaften mit. Jeder von uns hat ein anderes Verhältnis zu Risiko, Kontrolle und Sicherheit.
Vielleicht besteht Mut nicht darin, alles zu riskieren.Sondern darin, zu wissen, was man nicht riskieren will.
Und vielleicht gehört auch das zu einem aufrechten Leben: die eigenen Grenzen zu kennen, ohne sie mit denen anderer zu verwechseln.
Würdest du für ein Abenteuer dein Leben aufs Spiel setzen?
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit mutig.substack.com - Manchmal sind es Krisen, die uns an neue Orte führen. Robert Adler hat während der Pandemie als Quereinsteiger in einer steirischen Altersresidenz begonnen – eigentlich nur als Aushilfe. Geblieben ist er, weil er etwas gefunden hat, das ihn nicht mehr loslässt: echte Begegnungen. Heute arbeitet er bei der Volkshilfe in Laßnitzhöhe, betreut ältere Menschen, begleitet sie durch den Alltag – und hat aus seinen Erfahrungen ein Buch gemacht.
In unserem Gespräch erzählt Robert, wie aus spontanen Anekdoten ein literarisches Debüt wurde („Bitte das Rollo runterlassen, damit die Waschbären draußen nicht reinschauen können“). Wir sprechen über Humor als Schlüssel in der Betreuung, über Demenz und die Frage, wie man Nähe und Würde bewahren kann, wenn Sprache und Gedächtnis verschwinden.
Robert steht für eine Haltung, die berührt: klar, respektvoll, manchmal verspielt, immer zutiefst menschlich. Seine Geschichten lassen uns anders auf das Altern blicken – nicht als Defizit, sondern als Beziehung.
Ein Gespräch über das, was wirklich zählt: Aufmerksamkeit, Zuwendung und das gemeinsame Lachen.
🎙️ Jetzt reinhören
Sein aktuelles Buch:
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit mutig.substack.com - Was passiert, wenn eine Physikerin beginnt, soziale Systeme zu modellieren? Wenn sie versucht zu verstehen, wie sich digitale Dynamiken auf unsere Gesellschaft auswirken – und was wir dem entgegensetzen können?
In dieser Folge spreche ich mit Jana Lasser, Professorin für Data Analysis an der Uni Graz. Sie erforscht mit ihrem Team am IDea_Lab, wie sich das Verhalten von Menschen und Technologien gegenseitig beeinflusst – und wie daraus kollektive Phänomene wie Verschwörungserzählungen, Hasswellen oder digitale Meinungsblasen entstehen.
Wir sprechen über ihre ungewöhnliche wissenschaftliche Laufbahn – von der Physik zur sozio-technischen Forschung, über soziale Medien, Wahrheit im Netz, und über „Counterspeech“. Wie bleiben wir handlungsfähig inmitten von Komplexität und KI-getriebenem Wandel?
Und was bedeutet es, heute als junge Wissenschaftlerin durchzustarten?
👉 Eine Folge über Forschung mit Haltung, Wissenschaft als Orientierung – und darüber, was es braucht, um die Zukunft nicht nur zu analysieren, sondern mitzugestalten.
🎙️ Jetzt reinhören
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit mutig.substack.com
Weitere Wirtschaft Podcasts
Trending Wirtschaft Podcasts
Über MUTIG - Der Podcast
MUTIG ist ein Podcast über das Leben in unruhigen Zeiten. Gedanken, Geschichten und ausgewählte Gespräche über Alltag, Entscheidungen, und Reflexion. Verständlich, bodenständig und ohne Belehrung. mutig.substack.com
Podcast-WebsiteHöre MUTIG - Der Podcast, BTM-Podcast und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App

Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen


MUTIG - Der Podcast
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.