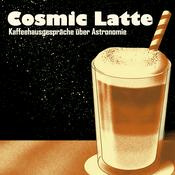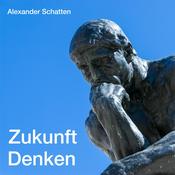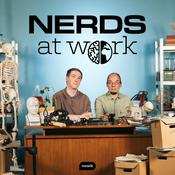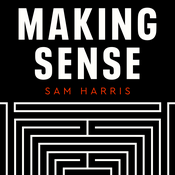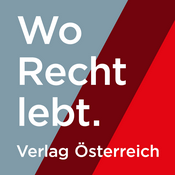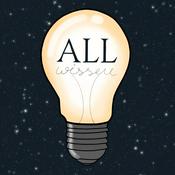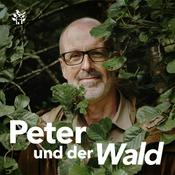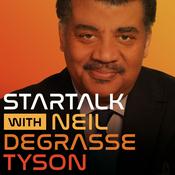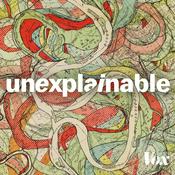AstroGeo - Geschichten aus Astronomie und Geologie
Karl Urban und Franziska Konitzer

Neueste Episode
133 Episoden
- In dieser Folge widmen sich Franzi und Karl dem Feedback zu den letzten beiden Geschichten im AstroGeo Podcast. Besonders gefallen hat ihnen die E-Mail einer Hörerin, deren Fantasie so sehr angeregt wurde, dass sie sich nun als Teil „eines unwahrscheinlich kleinen und zufälligen Teil eines riesigen und unfassbaren Zusammenhangs“ sieht. Herzlich willkommen in der Welt von AstroGeo!
Karl spricht über die korrekte Terminologie rund um Meteoroiden, Meteore, Meteoriten und Boliden. Das ist nämlich ein wenig mühsam: Ein Meteoroid ist ein kleinerer Gesteins- oder Eisbrocken auf einer Sonnenumlaufbahn. Tritt er in die Erdatmosphäre ein, wird er zum Meteor – gerne auch Sternschnuppe genannt. Und schaffen es Bruchstücke bis zur Erdoberfläche, heißen sie schließlich Meteoriten. Auch geht es nochmal darum, auf welchen Größenskalen die Ausdehnung des Universums stattfindet – ob nur jenseits von Galaxien oder auch auf dem Maßstab von Sternen, Planeten oder Atomen.
Dann geht es zurück in der Zeit, zu den ersten Sternen im Universum. Sie sind irgendwo da draußen, aber gefunden hat sie noch niemand. Franzi taucht dafür in die Prozesse ab, bei denen Sterne neue Elemente erbrüten: die Kernfusion von masseärmeren zu -reicheren Elementen. Genau jene massereicheren Elemente, von Astronominnen und Astronomen auch unter dem Sammelbegriff „Metalle“ abgehakt, sollte es nämlich in den sogenannten Sternen der Population III überhaupt nicht geben.
Zur Entstehung des Mondes gab es eine lebhafte Diskussion. Es ging erst einmal um den Befund selbst: Wie sicher ist es, dass ein marsgroßer Planet namens Theia mit der Protoerde zusammenstieß? Es geht um mögliche Szenarien für die Zeit danach, zum Beispiel, dass sich erst zwei Monde gebildet haben, die schließlich auch zusammenstießen und den heutigen Erdmond formten.
Karl erklärt auch die Europium-Anomalie, die als wichtiges Argument für den großen Einschlag gilt: Über den Gehalt des Seltenen Erd-Elements in den Mond-Hochländern und den vulkanischen Mare-Ebenen lässt sich belegen, dass der Mond schon vor der Bildung der großen Einschlagbecken über einen globalen Magmaozean verfügt haben muss.
Abschließend gibt es allgemeines Feedback zur Nutzung des Podcasts (nicht nur, aber auch zum Einschlafen), zu Wissen und Unwissen bei astrophysikalischern Modellen voller Dunkler Materie und Dunkler Energie sowie zum Einsatz KI-generierter Transkripte bei AstroGeo.
Episodenbild: Quelle: ESO/M. Kornmesser / CC-BY-SA 4.0 Rolf Hempel / Wikimedia Commons - Im Juni 1986 erlebten Planetenforscher einen Heureka-Moment. Denn sie waren zum ersten Mal einig, wie die Erde zu ihrem ungebührlich großen Mond gekommen ist. Diese Erklärung gilt bis heute als das wahrscheinlichste Szenario: Kurz nach der Entstehung der Erde vor rund 4,5 Milliarden Jahren stieß ein marsgroßer Planet mit der Protoerde zusammen. Aus dem verdampften Gestein, das dabei ins All geschleudert wurde, bildete sich wenig später der Mond.
Karl erzählt in dieser Folge, wie es zu diesem Heureka-Moment kam – denn nur wenige Jahre zuvor war die Forschungswelt noch hochgradig zerstritten, was die Entstehung des Mondes anging. Mindestens eine Handvoll Hypothesen war im Rennen. Man diskutierte, ob der Mond sich von der Erde durch allzu große Fliehkraft abgespalten hatte oder ob er friedlich an der Seite der Erde aus dem Urnebel gewachsen war. Andere glaubten an ein eingefangenes Objekt aus der kosmischen Nachbarschaft – oder sogar an eine natürliche, nukleare Explosion tief im Erdinneren nahe dem Erdkern.
Schon in den 1940er Jahren war dem kanadischen Geologen Reginald Daly aufgefallen, dass die mittlere Dichte des Mondes recht genau der Dichte des Erdmantels entspricht. Aber erst die astronautischen Mondlandungen des Apollo-Programms und die Proben verschiedener Raumsonden brachten ab 1969 Gewissheit: Erdmantel und Mond müssen aus dem gleichen Urmaterial entstanden sein. Gleichzeitig besitzt der Mond nur einen winzigen Eisenkern. Alles zusammen wirkte wie ein Sieb für die diversen Modelle der Mondentstehung. Übrig blieb am Ende nur der große Einschlag.
Trotz der klaren Hinweise bleiben bis heute einige Fragen offen. Zum Beispiel ist weiter unklar, warum zwar der Fingerabdruck der Sauerstoff-Isotope in Erdmantel und Mond sehr gut übereinstimmen – immerhin das häufigste Element von Erde und Mond – aber einige Spurenstoffe teilweise radikal abweichen. Dazu gehört der Anteil von Eisen und anderen Metallen, aber auch von flüchtigen Stoffe wie Wasser oder Kohlendioxid. Herausfordernd für die heutige Forschung ist vor allem das Wachstum des Mondes direkt nach dem großen Einschlag, bei dem es ziemlich heiß hergegangen sein muss. - Nicht viele Sterne können von sich behaupten, beinahe unser Verständnis vom Universum kaputt gemacht zu haben – aber ein Stern mit der Bezeichnung HD 140283 hätte es fast geschafft: Im Jahr 2000 schätzten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein Alter auf 16 Milliarden Jahre. Und damit wäre dieser so unscheinbare Stern älter als das Universum selbst Er liegt in rund 190 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Waage und ist von der Erde aus zwar nicht mit dem bloßen Auge, aber doch immerhin schon mit einem Fernglas sichtbar. Seinen Spitznamen als „Methusalem-Stern“ hat er sich damit mehr als verdient.
In den darauffolgenden Jahren korrigierten neue Messungen und Studien dieses Alter glücklicherweise nach unten. Inzwischen gilt HD 140283 zwar immer noch als alt, aber nicht mehr als älter als das Universum selbst. Trotz seines stolzen Alters ist eines wissenschaftlich sicher: Der Methusalem-Stern ist keiner von den allerersten Sternen, die es in unserem Universum je gegeben hat – doch auf die haben sie es abgesehen.
Forschende bezeichnen jene ersten Sterne im Universum auch als Sterne der Population III. Es sind die Sterne, die nach dem Urknall als erstes Licht ins Dunkel brachten. Damals, vor Milliarden von Jahren, gab es im Universum vor allem Wasserstoff und Helium. Erst die ersten Sterne haben jene massereicheren Elemente hergestellt, die wir heute kennen und schätzen – und ohne die es uns nicht geben würde: Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, und noch schwerere Elemente bis hin zum Eisen.
Somit ist zwar vollkommen klar, dass es diese ersten Sterne gegeben haben muss. Und doch haben Forschende noch nie einen solchen Stern beobachtet, trotz Jahrzehnten der intensiven Suche.
In dieser Folge erzählt Franzi von dieser Suche nach den Sternen der Population III, die Licht ins Universum gebracht haben – eine Suche, für die Forschende versuchen, mit dem James Webb-Weltraumteleskop so weit in die Vergangenheit zu blicken wie möglich. Aber auch unsere eigene Milchstraße bleibt ein möglicher Fundort für die wahren Methusalem-Sterne. - In dieser Folge widmen sich Franzi und Karl dem Feedback zu den letzten Geschichten im AstroGeo Podcast. Besonders schön war eine E-Mail von einer österreichischen Alm, mit Milchstraße, Satelliten und kindlichem Staunen über das „Mittendrinsein“ im Weltall.
Danach geht es zurück zu den Schwarzen Löchern und der Frage, warum eine Astronautin am Ereignishorizont von außen so wirkt, als sei sie eingefroren. Daneben geht es um Singularitäten, Gravitation und der Frage, was wir wirklich „sehen“, wenn wir die neuen Bilder Schwarzer Löcher betrachten.
Ausführlich wird über den Mars gesprochen: dessen dünne Atmosphäre, reale und mögliche Fluggeräte, die chemische Zusammensetzung und historische Irrtümer. Zuletzt geht es um die Besiedlung des Roten Planeten: Karl zweifelt am vermeintlich wirtschaftlichen Geschäftsmodell von SpaceX, das nebenbei diverse dramatische Folgen das Gemeinwohl auf der Erde hat, darunter zunehmend mehr Aluminium in der Atmosphäre, ein übervoller Erdorbit, das über Gebühr genutzte Frequenzspektrum oder die „Bestreifung“ astronomischer Beobachtungen – und das sogar für Weltraumteleskope wie Hubble. Es geht also um die fehlende Nachhaltigkeit von SpaceX – aber noch mehr: Karl erzählt vom Buch „A City on Mars“, das von der menschlichen Fortpflanzung jenseits der Erde handelt, die bis heute zahlreiche biologische und damit auch ethische Fragen aufwirft.
Auch zu Franzis Folge über das Ende des Universums gibt es Fragen: Es geht um Big Rip, Big Crunch, Big Freeze oder ob der Urknall eigentlich durch die bekannten Naturgesetze ausgelöst wurde. Es geht auch darum, ob im Podcast abseitige wissenschaftliche Hypothesen vorgestellt werden sollten – und wo Franzi und Karl ihre Rolle als Journalisten sehen – und wo nicht.
Bild vom Burger-Menü
Karl beantwortet Fragen zu Sodom und Gomorra und dem vermeintlichen Luftzerplatzer eines Meteoriten in der Bronzezeit: Hörende erzählen vom real existierenden Peer Review oder ihre Erfahrung mit Bibeltexten.
Zuletzt geht es um Feuersteine und Donnerkeile, eine besonders isländische Lieblingskarte aus dem Kartenspiel Magic und wie man AstroGeo ganz ohne Feedbackfolgen hören kann (über diesen Spezialfeed).
Episodenbild: Public Domain: John Martin (1852); ESO; NASA/JPL-Caltech/MSSS/Simeon Schmauß - Diese Folge ist ein Türchen der #WissPodWeihnacht: Des Adventskalenders von Wissenschaftspodcasts.de. Alle Folgen des Kalenders gibt es hier: https://wissenschaftspodcasts.de/adventskalender2025/
Während der Bronzezeit stand im Nordwesten des heutigen Jordaniens eine mächtige Stadt: Dicke Stadtmauern, eine mehrstöckiger Palast und ein 30 Meter hoher Wachturm sind nachgewiesen – doch diese Stadt sollte untergehen. Wie genau sie zerstört wurde, darüber wurde in den letzten Jahren ein wissenschaftlicher Disput geführt.
Karl erzählt in dieser Folge von der Ausgrabungsstelle Tell el-Hammam: Der Ort liegt 14 Kilometer nordöstlich des Toten Meeres im Jordantal. Hier siedelten Menschen schon zur Zeit der Römer, aber auch lange davor, über Tausende von Jahren wurden dort Städte aufgebaut und gingen wieder zugrunde. Im September 2021 veröffentlichte ein Team aus Archäologen, Geologen, Metallurgen und Materialwissenschaftlern im Fachmagazin Scientific Reports eine Studie, die zeigen sollte: Die Stadt sei in der Bronzezeit vor rund 3670 Jahren geradezu zertrümmert worden. Heiße Winde seien vom Himmel über die Stadt gekommen, hätten vier Meter breite Lehmziegel zerbröselt, Dachziegel geschmolzen und den Schutt samt dem Hausrat ihrer Bewohner über ein großes Areal verteilt. Schuld daran seien keine kriegerischen Auseinandersetzungen oder irdische Naturkatastrophen gewesen - sondern ein Meteorit aus dem All der über dem Toten Meer detoniert war und eine heiße Druckwelle ausgesandt hatte.
Die wissenschaftliche Arbeit korrespondiert mit einer Erzählung aus dem Alten Testament, die bis heute sprichwörtlich ist: Sodom und Gomorra mussten untergehen, weil der biblische Gott dort unhaltbare Zustände vorfand. Aber war das bronzezeitliche Tell el-Hammam wirklich eine Art Vorbild für das Sodom aus dem Buch Genesis des Alten Testaments – und wie gut sind die Argumente in der Studie?
Sie waren überhaupt nicht gut, wie sich kürzlich zeigte: Im April 2025 wurde die Studie von Scientific Reports zurückgezogen. Externe Forschende hatten manipulierte Fotos, falsch eingeordnete historische Vorbilder und Modelle gefunden. Es lag klar wissenschaftliches Fehlverhalten vor, das den Richtlinien des Journals widersprach.
Aber was steckt dahinter? Einen Hinweis geben die ursprünglichen Autoren selbst: Für die Grabung in Jordanien hatte ein Teil des Teams Gelder gemeinsam mit evangelikalen US-Gruppen gesammelt, die sich ihrerseits der Unfehlbarkeit der christlichen heiligen Schriften verschrieben haben. Es sind Vertreter des Kreationismus der alten Erde: Sie erkennen zwar naturwissenschaftliche Erkenntnisse an, etwa das Alter der Erde von 4,5 Milliarden Jahren. Doch gleichzeitig müssen wissenschaftliche Erkenntnisse für sie kompatibel mit der Bibel sein.
Weitere Wissenschaft Podcasts
Trending Wissenschaft Podcasts
Über AstroGeo - Geschichten aus Astronomie und Geologie
Im AstroGeo Podcast erzählen sich die Wissenschaftsjournalisten Franziskia Konitzer und Karl Urban regelmäßig Geschichten, die ihnen entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert – oder die sie in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Es sind wahre Geschichten aus Astronomie und Astrophysik, Geologie und Geowissenschaften.
Podcast-WebsiteHöre AstroGeo - Geschichten aus Astronomie und Geologie, Wissen Weekly und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App

Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.at App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen


AstroGeo - Geschichten aus Astronomie und Geologie
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.